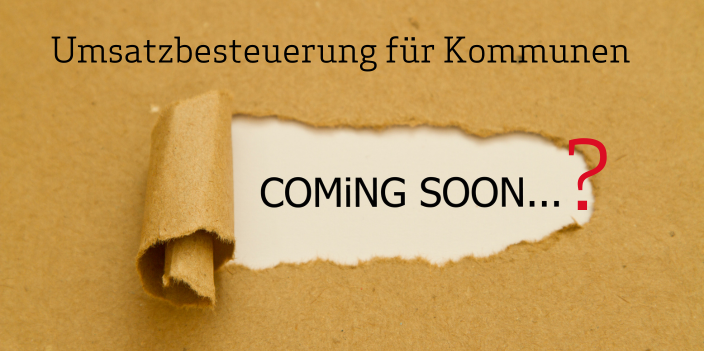Auf dem Weg zum vagabundierenden Zählpunkt
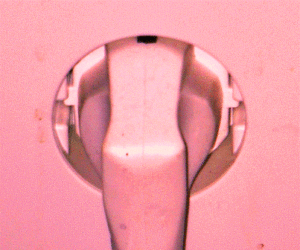
Was werden die Treiber der Elektromobilität? Wer diese Frage beantworten kann, hält den Schlüssel zum Erfolg der Elektromobilität in den Händen. Die größte Herausforderung an die Elektromobilität ist nicht die technische Realisierbarkeit alleine, dafür sorgen gerade findige Ingenieure und Techniker. Die Kernfrage ist: Was nutzt die Elektromobilität dem Kunden?
Kundenfreundlichkeit bedeutet vor allem eines: Alle Prozesse zur Abwicklung, d.h. Abrechnung, Bilanzierung und Beschaffung des Fahrstroms, müssen zumindest in nationale, wenn nicht gar europaweite energiewirtschaftliche Szenarien eingebettet und für den Fahrer ohne Komforteinbußen verwendbar sein. Was will der Kunde? Er möchte seinen Fahrstromlieferanten selbst auswählen. Sei es, dass er mit ökologisch guten Gewissen seinen „grünen“ Fahrstrom Co2-neutral überall bekommen kann – weshalb z.B. der VW-Konzern nach Stromerzeugungsanlagen aus Sonne, Wind- und Wasserkraft sucht und dafür 1 Milliarde Euro Investitionsbudget bereitstellt – oder sei es einfach ein Fahrstromdiscounter, der dem Kunden vor allem günstigen Strom anbietet.
Um dem Kunden an allen Ladepunkten im privaten, semi-öffentlichen und öffentlichen Bereich diese Möglichkeiten einzuräumen, reicht das oftmals zitierte „Roaming“ nicht aus. Ferner kennen heute die energiewirtschaftlichen Strukturen nur ortsgebundene Entnahmestellen. Der Zählpunkt, an dem energiewirtschaftlich der Lieferant beliefert, muss für den Erfolg der Elektromobilität mobil werden. Er muss sogar über alle Regelzonen hinweg „vagabundieren“ können. Dabei wird es nicht „das eine Modell“ geben, es wird ein Nebeneinander vieler Modelle sein: Der Fahrstromlieferant des Kunden fährt mit, oder der Kunde entscheidet sich bei jedem Ladevorgang neu, von wem er Strom bezieht oder der Ladesäulenbetreiber entscheidet, woher der Strom kommt.
Benutzerfreundlichkeit und Komfort werden über Erfolg oder Misserfolg der Elektromobilität entscheiden. Für diese Modelloffenheit müssen aber die energiewirtschaftlichen und -rechtlichen Rahmenbedingungen zwingend angepasst werden. Sie müssen es zulassen, dass das E-Mobil schnell, via Gleichstrom, langsam, an der „klassischen“ Schuko-Steckdose, oder induktiv unabhängig vom Standort des Fahrzeugs geladen werden kann.
Vor allem die Automobilkonzerne beschäftigen sich deshalb mit den daraus abzuleitenden Techniken für Abrechnung und Datenübertragung. Aber auch die Energieversorgungsunternehmen müssen sich Gedanken machen, wie sie mit mobilen Zählpunkten und einer neuen Erwartungshaltung der Kunden umgehen wollen. Denn ohne Kundenkomfort kann Elektromobilität nicht erfolgreich sein.
Ansprechpartner BBH Consulting: Dr. Andreas Lied
Ansprechpartner BBH: Dr. Christian de Wyl/Jan-Hendrik vom Wege